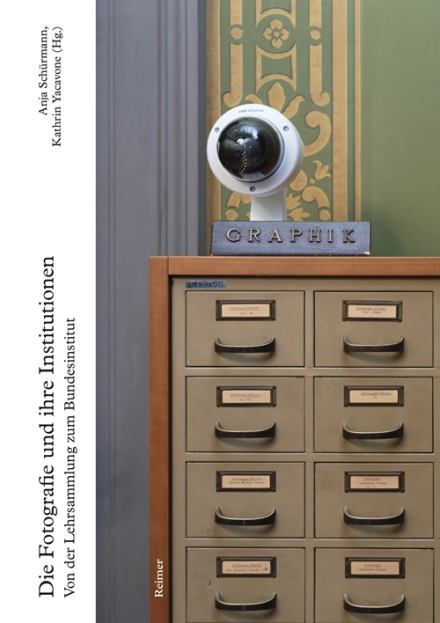
Im Kontext der ab 2019 erneut geführten Debatte um ein bundesdeutsches Institut für Fotografie ging es zuletzt mehr um den Standort (Essen oder Düsseldorf) als um die wesentliche Frage, welche Aufgabe diesem Institut zufiele.1 Während die Fotografieszene sich mehrheitlich ein zentrales Fotoinstitut als Kompetenzzentrum für eine Koordinierung und Förderung der bereits zahlreich existierenden Institutionen und Initiativen wünscht, entschied sich die Politik im Herbst 2022 für Düsseldorf als Repräsentantin der Fotografie als anerkannter Kunstform (Stichwort: Becher-Schule). Den politischen Willen mag Unwissenheit über die vielfältigen Ausdrucks- und Anwendungsformen eines schwer fassbaren Mediums und seiner über Jahrzehnte etablierten, längst weiter gewachsenen institutionellen Bewahrung beeinflusst haben. Oder waren die Ursache der eingeschränkten Sicht auf die Fotografie eher „Forschungslücken“, welche die beiden Herausgeberinnen Anja Schürmann und Kathrin Yacavone konstatieren?
Sie nahmen sich der Aufgabe an, Aspekte bereits vorhandener Institutionalisierung des fotografischen Mediums in Aufsätzen und mittels Gesprächen zusammenzutragen. Auch wenn ein Großteil des Bandes auf eine Tagung mit dem Titel „Die Fotografie und ihre Institutionen: Netzwerke, Sammlungen, Archive, Museen“ im Juni 2022 am Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen zurückgeht2, ist es dem Engagement der Herausgeberinnen zu verdanken, dass diese wertvolle Dokumentation im Umfang von 470 Seiten nun in Buchform vorliegt. In der Einleitung heißt es: „Aus verschiedenen kulturkritischen und praxeologischen Perspektiven sowie unter Berücksichtigung diverser Methodenansätze und Praxisbezüge werden hier die Logiken und Traditionen der Klassifizierung, Sammlung, Ausstellung, Archivierung, Vermarktung, Vermittlung und der Zirkulation fotografischer Bilder beleuchtet. Auch technische, industrielle, ökonomische und vorinstitutionelle Aspekte spielen eine Rolle […].“ (S. 9)
Entstanden ist eine veritable Kulturgeschichte der (deutschen) Fotografie vor allem seit 1945 – eine wahre Fundgrube mit in die (historische) Tiefe gehenden Aufsätzen zu einzelnen Institutionen oder Themen, eine unverzichtbare Grundlage für die weitere Diskussion zum „Bundesinstitut“ und für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Fotografie sowie mit der drängenden Frage, welche Manifestationen dieses vielfältigen Mediums wo und wie für nachfolgende Generationen bewahrt werden sollen. Der Band ist in zwölf Kapitel unterteilt. Diese enthalten auch insgesamt neun von den Herausgeberinnen geführte, stets von großer Sachkunde geprägte Interviews mit renommierten Vertreterinnen und Vertretern von Institutionen ‒ eine lebendige Bereicherung der Lektüre von knapp 30 Fachaufsätzen.
In der Kunstgeschichte ist es gängig, Bilder anhand fotografischer Reproduktionen zu studieren. Fotografie, respektive die fotografische Technik, ist hier also Werkzeug. Nach 1945, speziell ab den 1970er-Jahren, wurde „[a]us dem Dokument Fotografie, das Auskunft gab über das Aussehen eines anderen, […] das Monument Fotografie mit eigener Selbstbezüglich- und Wertigkeit“ (S. 12). Wie schwer greifbar die Fotografie als Gegenstandsbereich von Forschung und/oder Institutionalisierung ist, zeigt Kathrin Yacavone in ihrem Einführungsaufsatz „Für eine Institutionsgeschichte der Fotografie“. So kommt sie zum Beispiel auf die materielle Eigenlogik zu sprechen: „Der Bildbegriff ist in der Fotografie immer im Plural zu denken, denn Bilder sind sowohl Negative, Abzüge, Unikate, Reproduktionen als auch digitale Erscheinungsformen, die wiederum, in Abhängigkeit von diesen, in institutionellen Kontexten an Werte- und Ordnungslogiken geknüpft sind.“ (S. 29)
Interessant ist hierzu das Gespräch mit Peter Geimer und Bernd Stiegler zur Frage, warum sich eine Fotowissenschaft nie als universitäre Disziplin etabliert habe, während es eine Filmwissenschaft gibt. Stiegler überlegt, „ob es der Fotografie wirklich gut täte, sich wie die Filmwissenschaft institutionell zu etablieren. Bei der Filmwissenschaft, die letztlich dennoch recht randständig geblieben ist, habe ich den Eindruck einer Überphilologisierung und extrem filigranen Historisierung, die mich schon bei der Literaturwissenschaft so gestört hat, dass ich zur Fotografie gekommen bin. Daher bin ich mit der mäandernden Existenz der Fotografie in der Wissenschaft letztlich doch recht glücklich. Das ist die ihr vielleicht am ehesten entsprechende Existenzform.“ (S. 93) Geimer stimmt dem grundsätzlich zu.
Wie schon erwähnt, handelt sich bei dem vorliegenden Band um eine Fundgrube an Themen und historischen Aufarbeitungen, die für die weitere Forschung sicher nützlich sind. Nachfolgend sei auf einige Highlights und Zusammenhänge quer zu den Kapiteln verwiesen. An erster Stelle – auch im Buch – ist der erhellende Beitrag von Steffen Siegel über Otto Steinert zu nennen, dessen Bedeutung vor allem als Lehrender für die Wertschätzung der Fotografie in Deutschland kaum hoch genug angesetzt werden kann. Zudem geht es um die Entstehung der Fotografischen Sammlung im Museum Folkwang. Der illustrierte Aufsatz wird ergänzt durch eine Liste mit den von Steinert in Essen kuratierten 20 Ausstellungen zwischen 1959 und 1978 (S. 54f.).
Eine Perle ist auch der Beitrag von Nadine Kulbe zur Frage „Wie Amateurfotograf:innen mit ihren privaten Fotoarchiven umgehen“, zumal die Autorin speziell die Amateurfotografie in der DDR in den Blick nimmt. Wie sich „Die Wende der ‚freien‘ Fotografie“ vollzog, kann man im Beitrag von Sandra Neugärtner nachlesen. Die beiden Texte stehen unter der Überschrift „Vorinstitutionelle Ordnungslogiken“.
Im Abschnitt „Industrielle Archive“ berichten Michael Farrenkopf und Stefan Przigoda über fotografische Überlieferungen beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum („Von der industriellen Gebrauchsfotografie zum historischen Kulturgut“). Anhand des Historischen Archivs Krupp erläutert Manuela Fellner-Feldhaus „Logiken des Archivierens“ und deren Wandel im Umgang mit Fotografie. Damit sind nur zwei Beispiele für die inhaltliche Vielfalt der Anthologie in Richtung Spezialarchive genannt.
Im Kontext Fotografie als Dienerin der Kunstgeschichte findet man eine konzise Historie des Bildarchivs Foto Marburg von Hubert Locher. Interessante Ergänzungen dazu sind der Beitrag über die Sammlung Fotografie im Städel Museum Frankfurt am Main (Kristina Lemke) sowie das Interview mit Jens Bove, Simone Fleischer und Agnes Matthias (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), die über die in 100 Jahren erfolgte Wandlung von der Landesbildstelle zur Fotothek sprechen. Agnes Matthias betreut das „Archiv der Fotografen“ in der Deutschen Fotothek. Schon die schiere Menge des Materials ist beeindruckend und herausfordernd: Nach eigenen Angaben enthält die Deutsche Fotothek einen Gesamtbestand von rund sieben Millionen Fotografien.
Ein überaus relevanter Gesichtspunkt in der Diskussion über ein bundesdeutsches Fotoinstitut ist ja nicht nur die in diesem Band vermittelte Erkenntnis, dass es bereits etliche Institute mit langer Tradition und umfangreichen Sammlungen gibt, sondern auch die Notwendigkeit, Vor- und Nachlässe zu sichern und zu erschließen. „Denn darum muss es ja in erster Linie gehen: Vor- und Nachlässe zusammenzuhalten und sie so aufzubereiten und zu verarbeiten, dass sich neue Forschungsräume auftun“, heißt es an anderer Stelle bei Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton (S. 235).
In Dresden werden ungefähr 200 Archive von Fotografinnen und Fotografen bewahrt. „Das ist viel oder wenig. Je nach Blickwinkel“, sagt Jens Bove und erwähnt zwei Berufsverbände: „Allein der BFF (Berufsverband Freier Fotografen und Formgestalter e.V.) hat aktuell mehr als 500 Mitglieder, Freelens deutlich über 2000.“ (S. 269) Agnes Matthias ergänzt: „Allein diese Zahlen zeigen, dass nicht jedes fotografische Schaffen bewahrt werden kann. Der Aufbau einer qualitätvollen Sammlung ist immer ein Auswahlprozess, ein oft schmerzhafter, aber notwendiger Prozess des Kuratierens. Selbst der Anspruch, alle forschungsrelevanten Archive zu erhalten, ist kaum einlösbar, sollte aber dennoch Ziel sein, immer verbunden mit dem Gedanken, dass wir heute noch nicht genau wissen können, was in Zukunft relevant sein wird.“ (S. 269f.) Es bietet sich an, dazu im Kapitel „Pressearchive und -nachlässe“ den Beitrag von Miriam Zlobinski über das analoge „Stern“-Fotoarchiv nachzulesen, das sich seit 2019 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München befindet und inzwischen teilweise online verfügbar ist.3
Nach dem Ende der photokina als Weltmesse des Bildes 2018 wird sicher bald auch Köln zum Gegenstand universitärer Arbeiten zur Fotohistorie. Neben dem Beitrag von Clara Bolin zur erstmals 1950 veranstalteten photokina schreibt Daria Bona über die „Institutionalisierung fotografischer Lehre in Köln“. Einen Köln-Bezug hat auch das Interview mit dem Verleger und Buchhändler Markus Schaden über das Fotobuch, in dem er konstatiert: „Fotobücher werden institutionell bis heute – wenn überhaupt – allenfalls als Referenz oder Quelle hinzugezogen (man lese sich nur einmal die Konzepte des geplanten Fotoinstituts durch, in denen das Fotobuch keine Erwähnung findet).“ (S. 384) Schaden ist Initiator des 2014 in Köln gegründeten „PhotoBookMuseum“, das bislang noch keinen festen Standort hat.
„Es wird interessant“, heißt es im Interview mit Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton, „wenn die Gründungskommission finale konzeptionell-inhaltliche Leitlinien für das Bundesinstitut ausgearbeitet hat. Sich dann zu überlegen, wie die unterschiedlichen Erscheinungsweisen des Fotografischen zusammengedacht und in ein System gebracht werden können, ist die Herausforderung, der sich die Verantwortlichen stellen müssen. Bestimmt muss nicht alles neu erfunden werden. Es gibt ja Institutionen, […] die – im besten Falle – eine bereits funktionierende Struktur etabliert haben.“ (S. 235) Genau in der Mitte des Bandes (S. 240–257) findet sich eine detaillierte „Zeitleiste“ mit diversen Institutionalisierungsformen von 1845 bis 2024. Ob es für die Fotografie das im Buchtitel annoncierte „Bundesinstitut“ je geben wird, bleibt abzuwarten. Die vorliegende Anthologie bietet eine ausgezeichnete Basis für die fundierte inhaltliche Konzeption einer bundesweit agierenden, die bestehenden Institutionen vernetzenden Einrichtung. Der gewichtige Band gehört in jede Fachbibliothek. (Dr. Martina Mettner für H / SOZ / KULT)
Anmerkungen:
1 Siehe https://www.netzwerk-fotoarchive.de/lesenswert/das-geplante-bundesdeutsche-fotoinstitut-konzepte-und-debatten (19.03.2025). Es gab schon zuvor Versuche, ein zentrales Bundesinstitut für die Fotografie zu gründen. Kathrin Yacavone erläutert die Vorgeschichte in diesem Beitrag: Aufrufe, Konzepte und Fehlschläge. Eine fotohistorische Perspektive auf die Debatte um ein Bundesinstitut für Fotografie, in: Rundbrief Fotografie 30 (2023) 3, S. 46–53.
2 Vgl. den Bericht von Vera Knippschild, in: H-Soz-Kult, 14.12.2022, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-131842 (19.03.2025).
3 Siehe https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/stern-fotoarchiv/ (19.03.2025).